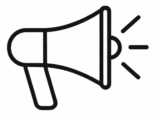Der Stadtteilansatz – kurz vorgestellt – Basis- & Stadtteilarbeit in der Praxis
05. Dezember 2025Der Stadtteil ist für uns in jeder Stadt das strategische Zentrum unserer aktuellen Arbeit – in ihm und um diesen rum versuchen wir eine Verankerung vor Ort aufzubauen, unsere Positionen zu verbreiten und diskutierbar zu machen. Sevil und Tobias möchten im folgenden Interview Einblicke in unseren Ansatz geben, was wir uns davon erhoffen und wie dieser in der Praxis aussieht.
Wie seid ihr denn zum Stadtteilansatz gekommen?
Sevil: Für uns wurde irgendwann deutlich, dass viele politische Ansätze an der Lebensrealität der Menschen vorbeigehen. Viele Konflikte, die im Alltag der Menschen eine große Rolle spielen – steigende Mieten, Energiekosten, Stress, fehlende Treffpunkte – spielen sich nicht irgendwo abstrakt ab, sondern direkt im Stadtteil. Wir wollten da ansetzen, wo das Leben stattfindet, und haben gemerkt: Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, müssen wir uns dort verankern und dort kämpfen, wo wir unseren Alltag haben.
Tobias: Dabei ist uns wichtig, den Stadtteil auch als einen Ort von Klassenauseinandersetzungen zu begreifen, in dem Angriffe auf unsere Lebensbedingungen ganz direkt stattfinden. Dort wollten wir ansetzen. Dabei hat der Stadtteil als ein zentraler Ort, an dem unsere Klasse zusammenkommt, auch an Bedeutung gewonnen. Denn die 1-2 Betriebe, in denen alle arbeiten, gibt es heute nicht mehr, sondern die Arbeitswelt ist durch die Dienstleistungsgesellschaft viel ausdifferenzierter geworden. Dem müssen wir auch Rechnung tragen – ohne dabei zu sagen, dass der Betrieb nicht ebenfalls ein wichtiges Kampffeld ist, das wäre allerdings ein eigenes Interview.
Sevil: Daher kommen dann im Stadtteil auch die unterschiedlichsten Erfahrungen, Probleme und Perspektiven zusammen und die kapitalistische Realität zeigt sich ganz konkret – zum Beispiel beim Wohnen, in den alltäglichen Problemen oder auch in der Vereinzelung und Isolation jedes/jeder Einzelnen. Der Stadtteil war für uns deshalb nicht ein beliebiges Feld, sondern ein logischer Ausgangspunkt: ein Raum, in dem unsere Klasse zusammenkommt und aus vereinzelten Interessen gemeinsame Interessen entstehen können.
In euren Leitlinien sprecht ihr von Basis- und Stadtteilarbeit und der Verbindung zwischen den beiden. Könnt ihr kurz darlegen, was ihr unter Basis- und Stadtteilarbeit versteht?
Sevil: Basisarbeit heißt für uns: Wir setzen an dem an, was Menschen wirklich betrifft – an ihrem Alltag, ihren Problemen und Bedürfnissen. Oder anders gesagt: wir setzen an den konkreten Auswirkungen kapitalistischer Herrschaft, sowie patriarchaler und rassistischer Strukturen für unsere Klasse an. Dafür greifen wir die daraus entstehenden Widersprüche und Probleme auf, verallgemeinern diese und versuchen daraus kollektive Kämpfe zu entfachen. Es geht dabei aber nicht um eine einzelne Kampagne, sondern um eine langfristige Verankerung von linker Politik und linken Positionen im Alltag der Menschen. Es geht aktuell auch viel darum, linke Politik wieder zu normalisieren.
Tobias: Und Stadtteilarbeit bringt diese Basisarbeit an den Ort wo die Menschen zusammenkommen und leben – in den Stadtteil. Hier greifen wir dann die konkret spürbaren Widersprüche auf und gehen gemeinsam gegen diese vor. Oder tragen auch politische Themen in den Stadtteil rein. Außerdem werden durch Stadtteilläden und -zentren Räume geschaffen in denen Menschen sich treffen und kollektive Momente erleben können. Räume, in denen sie sich austauschen, solidarisch handeln und gemeinsam aktiv werden können. Das ist in einer Zeit, in der viele vereinzelt sind und sowieso das Gefühl haben, nichts ändern zu können, notwendig und wichtig.
Sevil: Ich möchte noch ergänzen, dass Stadtteilarbeit auch eine Praxis ist, die auf Beziehungen beruht. Sie zwingt uns, präsent zu sein und auch zuzuhören. Es entsteht mit der Zeit eine Verankerung. Menschen möchten mit uns über unsere Positionen diskutieren und schließen sich auch Protesten an – selbst wenn sie teils anderer Meinung waren oder es sogar noch sind. Es zeigt, dass Veränderung von unten entstehen kann, indem Menschen sich im eigenen Viertel organisieren.
Tobias: Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass wir uns dabei nicht aus diesen Auseinandersetzungen rausnehmen. Wir sind nicht die Sozialarbeiter*innen, sondern wir sind auch Teil der Klasse und haben die gleichen Probleme, den gleichen Stress und die gleichen Ängste. Wir schaffen zwar einen kollektiven Rahmen, in dem damit umgegangen werden kann, aber wir nehmen auch selber viele Eindrücke und Impulse mit – die für unsere Praxis aber auch für unseren Alltag hilfreich sind.
Und wie sieht die konkrete Praxis aus?
Sevil: Ganz praktisch heißt das: Wir haben oder nutzen Räume im Stadtteil, organisieren Veranstaltungen, Diskussionsrunden, Feste und Aktionen. Außerdem legen wir sehr viel Wert darauf, dass man uns und unsere Positionen im Stadtteil wahrnehmen kann – durch Plakate, Aufkleber, Flyer usw. Dazu gehören dann auch Flyerverteilungen in Briefkästen oder auch kreative Aktionen.
Dabei greifen wir Themen auf, die gerade im Viertel brennen, wie z.B. ein Luxusbau, Superblocks, hohe Mieten etc. und versuchen, Protestformen oder einen kollektiven Umgang damit zu entwickeln. Es ist uns aber auch gleichzeitig wichtig, andere Themen – wie Krieg und Militarisierung – in den Stadtteil zu tragen und diese dort präsent zu machen. Dadurch entstehen Gespräche und Diskussionen, von denen wir auch viel mitnehmen und lernen können, da wir mit Leuten aus unserer Klasse aber auch außerhalb unserer Bubble diskutieren.
Tobias: Wir denken, dass es auch wichtig ist, dabei neben der politischen auch auf sozialer und kultureller Ebene zu wirken – sprich soziale Anlaufpunkte zu schaffen, wie Kneipen und ähnliches anzubieten und natürlich eine solidarische Kultur zu etablieren.
Das alles geht natürlich nicht von heute auf morgen. Daher sprechen wir meist davon, dass wir keinen Sprint, sondern eher einen Marathon laufen – d.h. wir arbeiten bewusst langfristig. Statt punktueller Aktionen setzen wir auf Kontinuität: offene Treffen, regelmäßige Präsenz, Diskussionsrunden, Beratungen, feste Räume. Wichtig ist, dass Menschen uns kennen, uns begegnen, uns als Teil des Stadtteils wahrnehmen und auch die Möglichkeit haben, auf uns zuzukommen.
Ihr habt jetzt beschrieben, wie eure Arbeit konkret aussieht. Lasst uns über die Wirkung und Herausforderungen sprechen: Wo hat der Ansatz gut funktioniert und wo seid ihr an Grenzen gestoßen?
Sevil: Eine deutliche Grenze ist immer die Frage der Ressourcen. Stadtteilarbeit braucht viel Zeit, Engagement und Kontinuität. Wenn wir in einem Viertel keine stabile Präsenz halten können, wirkt sich das sofort aus.
Tobias: Und natürlich stoßen wir an gesellschaftliche Grenzen: Es ist manchmal nicht ganz einfach, eine andere Position als die aktuell hegemoniale Meinung zu vertreten und dann auch noch ansprechbar zu sein. Und auch die Vorstellung, dass alle ihr eigenes Ding machen müssen, sitzt tief. Außerdem haben viele Leute auch angesichts von Arbeitsverdichtung & Co. wenig Energie übrig, um sich zu engagieren. Manchmal ist der Alltag so belastend, dass Organisierung schwerfällt. Diese Haltungen zu verändern, dauert.
Sevil: Aber es gibt natürlich auch Erfolge: Ich sehe die größten Erfolge darin, dass wir als Anlaufstelle und Ansprechpartner*innen wahrgenommen werden. Menschen kommen auf uns zu, wenn Probleme auftauchen oder wenn sie Unterstützung suchen, um gemeinsam etwas gegen ein Problem zu unternehmen. Dass wir Teil des Viertels sind – das ist schon ein Ergebnis, auf das man aufbauen kann.
Tobias: Genau, oft kommen Leute auf uns zu und wollen mit uns über unseren letzten Flyer, den wir verteilt haben, diskutieren oder sagen, dass wir doch eigentlich was zu dem Thema machen sollten und sehen uns als Ansprechperson für eine politische Veränderung. Das, finde ich, darf nicht unterschätzt werden.
Ihr habt von Kontinuität und Verankerung gesprochen. Lasst uns über die Orte sprechen, die das möglich machen: Ihr seid in Nürnberg in der Schwarzen Katze, in Stuttgart im Stadtteilzentrum Gasparitsch und in Schwäbisch Gmünd entsteht etwas Neues: Welche Rolle spielen diese Räume für eure Arbeit?
Sevil: Die Räume sind für uns absolut zentral, weil sie etwas ermöglichen, was im Alltag oft fehlt: kollektive Momente, Begegnung und Austausch zwischen Menschen, die sich sonst nie begegnen würden. Das Stadtteilzentrum Gasparitsch beschreibt das in seiner Stadtteilzeitung sehr treffend, wenn es sagt, dass es darum geht, Räume zu schaffen, in denen Menschen zusammenkommen, voneinander lernen und gemeinsam aktiv werden können. Genau das passiert in solchen Stadtteilläden: Sie sind offen, niedrigschwellig, zugänglich – und schaffen damit eine Atmosphäre, in der Nachbar*innen sich trauen vorbeizuschauen, Themen einzubringen und sich zu beteiligen. Ohne solche Räume wäre es viel schwerer, Beziehungen aufzubauen und uns mit unserer Stadtteilarbeit wirklich im Alltag der Menschen zu verankern.
Tobias: Ich würde sagen, dass die Stadtteilläden neben der ganz praktischen materiellen Infrastruktur auch die soziale Infrastruktur unserer politischen Arbeit sind. Sie bieten nicht nur Platz für Treffen und Veranstaltungen, sondern vor allem einen Ort, an dem Menschen erleben können, dass sie nicht allein sind mit ihren Problemen. Es geht darum, gemeinsame Erfahrungen zu ermöglichen, gegenseitige Unterstützung zu organisieren und einen Ort zu schaffen, an dem Leute merken: Hier kann ich einfach sein und mich auch einbringen, wenn ich möchte. Für langfristige Organisierung sind solche Räume unverzichtbar, weil sie Räume des Stadtteils sind – Orte, an denen Beziehungen wachsen und politische Prozesse entstehen können.
Der Ansatz ist ja sehr stark auf die konkreten Probleme des Alltags fokussiert. Das hat Vor- und Nachteile. Einerseits wird es konkret und greifbar, andererseits birgt es die Gefahr, dass man das „große Ganze“ – also das Ziel einer befreiten Gesellschaft aus dem Blick verliert. Wie geht ihr damit um?
Sevil: Diese Spannung kennen wir natürlich. Aber für uns schließen sich Alltag und große Perspektive nicht aus – im Gegenteil, sie hängen voneinander ab. Menschen entwickeln oft erst dann ein Bewusstsein für grundlegende gesellschaftliche Fragen, wenn sie erleben, dass sie mit den alltäglichen Problemen zusammenhängen und diese auch verändern können. Das geht mir ja ganz genau so. Gerade in diesen konkreten Kämpfen können wir Selbstbewusstsein entwickeln,erfahren Solidarität und ein Gefühl für kollektive Stärke. Wenn wir dort präsent sind und politische Zusammenhänge verständlich machen, dann verbinden wir die alltäglichen Konflikte mit dem größeren Ziel einer anderen Gesellschaft – ohne den Leuten einfach theoretische Modelle überzustülpen.
Tobias: Ich sehe das auch so. Der Alltag ist der Ausgangspunkt, aber nicht der Endpunkt. Wir machen aus unseren politischen Vorstellungen keinen Hehl: Wir wollen eine Gesellschaft, in der die Menschen im Zentrum stehen und nicht der Profit. Das sagen wir auch offen. Aber wir wissen, dass man Menschen dafür nicht „überzeugen“ kann, indem man ihnen das von außen erklärt. Das entsteht in gemeinsamen Erfahrungen. Unser Ziel ist es, konkrete Kämpfe und die grundsätzliche Perspektive miteinander zu verbinden – also konkrete Verbesserungen zu erkämpfen und gleichzeitig sichtbar zu machen, welche Grenzen dieses System setzt. Dadurch bleibt das große Ganze immer präsent, ohne dass wir den Alltag aus den Augen verlieren.
Und zum Abschluss: Warum haltet ihr denBasis- & Stadtteilansatz für den richtigen?
Tobias: Also um es kurz und bündig zu beantworten: Dieser Ansatz lässt linke und revolutionäre Politik greifbar werden, normalisiert Positionen und schafft Verankerung. Das alles braucht es für eine nachhaltige Veränderung – und oft war es ja so, dass gerade die Brücke zwischen der richtigen Idee und der Verankerung in der Klasse gefehlt hat. Das kann der Basis- und Stadtteilansatz leisten.
Daher ist es wichtig, dass wir nicht auf unsere Inhalte verzichten und aus unserem Ziel keinen Hehl machen: Wir stehen ein für eine ganz andere Gesellschaft, für eine, die die Bedürfnisse der Menschen an die erste Stelle stellt und nicht den Profit. Das gilt es immer wieder zu betonen.
Sevil: Für mich ist der Stadtteil ein Ort, an dem wir alle ein kollektives Handeln wieder erlernen können. Ohne diese Erfahrungen bleiben gesellschaftliche Visionen abstrakt. Wenn Menschen im Viertel gemeinsam Probleme angehen – ob Mieten, Energie, Infrastruktur oder soziale Isolation – entsteht eine Form von Zusammenhalt, die man als Voraussetzung für jede Idee einer klassenlosen Gesellschaft sehen kann.
Stadtteilarbeit ist dabei ein Baustein unter vielen weiteren auf dem Weg zu einer Gesellschaft, in der Menschen ihre Lebensbedingungen selbst gestalten können. Wenn Nachbar*innen gemeinsam aktiv werden, merken sie, dass sie Einfluss haben und nicht allein sind. Zudem verankern wir uns und unsere Positionen durch unsere Präsenz – wir werden ansprechbar und normalisieren darüber auch linke und revolutionäre Positionen.